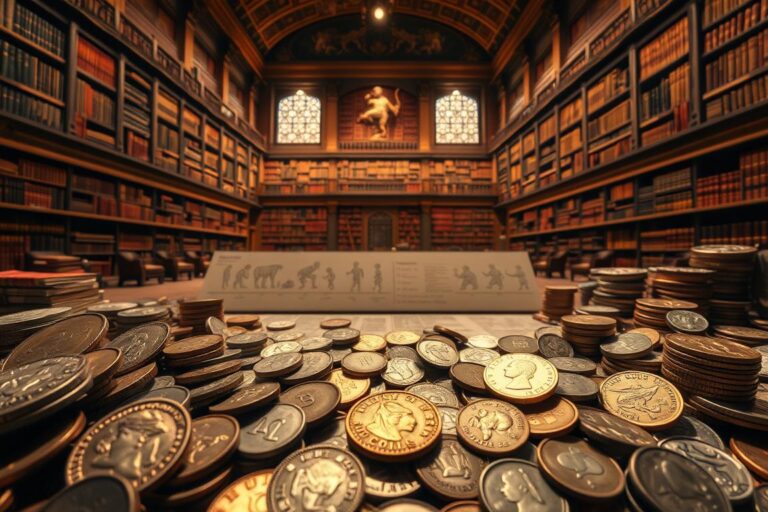Seit wann gibt es Palästina nicht mehr
Wussten Sie, dass 145 von 193 UN-Mitgliedstaaten den Staat Palästina anerkennen (Stand: 29. Mai 2024)? Trotz dieser anerkennenden Mehrheit stellt sich die Frage: Seit wann gilt Palästina denn als nicht mehr existent? Die Antwort auf diese Frage führt uns tief in die Geschichte der Region und beleuchtet die komplexen politischen und historischen Entwicklungen.
Die Geschichte Palästinas ist sowohl reich an kulturellen als auch an politischen Wendungen. Von der Ära des britischen Mandats über den UN-Teilungsplan von 1947 bis hin zur Unabhängigkeitserklärung von 1988 – all diese Ereignisse haben die Identität und die internationale Anerkennung Palästinas nachhaltig geprägt. Ein genauer Blick auf die Meilensteine in der Palästina Geschichte ist notwendig, um die moderne politische Landschaft und die aktuelle Anerkennung Palästinas besser zu verstehen.
Hauptpunkte
- 145 von 193 UN-Mitgliedstaaten erkennen den Staat Palästina an (Stand: 29. Mai 2024).
- Der jüdische Bevölkerungsanteil in Palästina stieg bis 1945 auf rund 30 Prozent.
- Der UN-Teilungsplan von 1947 sah eine Aufteilung Palästinas in zwei Staaten vor.
- Am 15. November 1988 rief die PLO den Staat Palästina aus.
- Der Status der Palästinensischen Autonomiebehörde wird nicht von Deutschland als Staat anerkannt, aber es bestehen diplomatische Beziehungen.
Historischer Ursprung des Namens Palästina
Der Begriff „Palästina“ taucht erstmals im 12. Jahrhundert v. Chr. auf und hat seitdem eine lange und komplexe Geschichte. Im 5. Jahrhundert v. Chr. bezeichnete der griechische Historiker Herodot das Gebiet als „palästinisches Syrien“. Während dieser Zeit war das Gebiet unter verschiedenen Reichen und Dynastien verwaltet, bis hin zur Umbenennung durch den römischen Kaiser Hadrian im Jahr 135 n. Chr. in „Syria Palaestina“.
Bis ins 2. Jahrhundert n. Chr. wurde das Gebiet ausschließlich als „Judäa“ bezeichnet. Schon damals fand der Begriff „Palästina“ eine zunehmende Verwendung und symbolisierte eine historische Verbindung zum biblischen Israel. Der Verlust der Eigenständigkeit markierte einen bedeutenden Einschnitt und prägt die Wahrnehmung des historischen Palästina bis heute.
Im Lauf der Jahrhunderte kamen weitere historische Ereignisse hinzu, die die Region Palästina Verlust erleben ließ. Beispielsweise führte der Jüdische Krieg (66-70 n. Chr.) zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Der Bar-Kochba-Aufstand (132-135 n. Chr.) und die darauffolgende Umbenennung der Region spielten ebenfalls eine zentrale Rolle. Die islamische Eroberung Palästinas zwischen 632 und 640 n. Chr. änderte die Verwaltung und das Leben in der Region erheblich.
Die historische Bedeutung Palästinas zeigt sich auch in den Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Das britische Mandat für Palästina, das am 24. Juli 1922 erklärt wurde, inkludierte auch das heutige Jordanien. Während der Mandatszeit bis 1948 wurde jede Person mit palästinensischer Staatsbürgerschaft als Palästinenser bezeichnet, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit. Diese Periode führte zu einem weiteren Palästina Verlust und legte die Grundlage für die komplexen politischen Entwicklungen, die auf die Gründung des Staates Israel und darüber hinaus folgten. Der Name ‚Palästina‘ bleibt ein Symbol für die tief verwurzelte Geschichte und die fortdauernden politischen Herausforderungen in der Region.
Das britische Mandat und die UN-Teilungspläne
Das britische Mandat Palästina war eine entscheidende Phase in der Geschichte des Nahostkonflikts. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde das Völkerbundsmandat für Palästina am 19. April 1920 dem Vereinigten Königreich zugesprochen und am 24. Juli 1922 vom Rat des Völkerbundes ratifiziert. Ursprünglich erstreckte sich das Mandat von 1921 bis 1923 auch auf Transjordanien.
Palästina war eine vielseitige und ethnisch vielfältige Region. Im Oktober 1922 betrug die Bevölkerung insgesamt 757.182 Menschen, davon waren etwa 77,9% Muslime, 11,1% Juden, 9,6% Christen und 0,9% Drusen. Bis 1948 stieg der jüdische Bevölkerungsanteil auf 33% an, bedingt durch die Einwanderung von etwa 100.000 jüdischen Immigranten zwischen 1917 und 1945.
Das britische Mandat Palästina war jedoch von zahlreichen Konflikten geprägt. Der Arabische Aufstand von 1936 bis 1939, angeführt von Mohammed Amin al-Husseini, führte zu erheblichen Spannungen. Die Aufstände kosteten etwa 10% der palästinensischen Bevölkerung das Leben und hinterließen tiefe Spuren in der Region.
Die UN-Teilungsplan 1947, verabschiedet am 29. November 1947, sah eine Aufteilung des Mandatsgebiets in einen jüdischen und einen arabischen Staat vor. Der Plan, bekannt als UN-Resolution 181, wurde von den jüdischen Führern weitgehend akzeptiert, während die arabischen Staaten und die palästinensischen Führer ihn ablehnten. Der israelisch-palästinensische Konflikt verschärfte sich weiter, als am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit Israels erklärt wurde. Am selben Tag, dem offiziellen Ende des britischen Mandats, stationierten sich Truppen aus Israel, Ägypten, Syrien, Jordanien, Irak und Libanon in Palästina.
Der israelisch-palästinensische Konflikt bleibt bis heute ungelöst, und die historischen Ereignisse des britischen Mandat Palästina und des UN-Teilungsplan 1947 haben bleibende Auswirkungen auf die Region.
Israel und der Palästinakrieg 1948
Der Palästinakrieg 1948 war eine zentrale Episode im Israel Palästina Konflikt, deren Auswirkungen bis heute nachwirken. Die jüdische Bevölkerung in Palästina, die bis 1917 nur etwa 85.000 Menschen ausmachte, wuchs bis Ende 1946 auf etwa 603.000. Zu Beginn des Palästinakriegs betrug die jüdische Bevölkerung etwa 700.000, während etwa 1,2 Millionen Araber dort lebten. Der UN-Teilungsplan von 1947 sah vor, dass 67% der Bevölkerung in Palästina nicht-jüdischen Religionen angehörten, was zu Spannungen und Konflikten führte.
Die militärischen Auseinandersetzungen begannen unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung Israels am 14. Mai 1948, als fünf arabische Staaten (Ägypten, Irak, Libanon, Transjordanien und Syrien) Israel mit insgesamt etwa 55.000 Soldaten angriffen. Während des Krieges wurden etwa 750.000 palästinensische Araber zu Flüchtlingen, bekannt als die Nakba (Katastrophe). Zeitgleich verließen ebenfalls etwa 750.000 Juden arabische Staaten.
Der Krieg gliedert sich in zwei Hauptphasen. Die erste Phase, der Guerillakrieg im Mandatsgebiet, dauerte vom 30. November 1947 bis zum 15. Mai 1948. Danach folgte die Intervention der arabischen Armeen bis zum 20. Juli 1949. Während dieser Zeit wurden mehrere Waffenstillstandsabkommen von Februar bis Juli 1949 unterzeichnet. Letztlich bleib 75% des ehemaligen Mandatsgebiets bei Israel, wodurch sich das israelische Territorium im Vergleich zum UN-Teilungsplan um ein Drittel vergrößerte.
Allein die Zahlen verdeutlichen die enormen Verluste und Tragödien dieses Konflikts. Rund 5.000 palästinensische Aufständische starben während des arabischen Aufstands, 10.000 wurden verwundet, und 5.679 inhaftiert. Diese Verluste sind ein prägnantes Beispiel für die komplexen und oftmals tragischen Facetten des Israel Palästina Konflikts.
Seit wann gibt es Palästina nicht mehr
Palästina existiert nicht in der Form, wie es sich viele vorstellen, doch es bleibt ein bedeutendes Thema in der internationalen Politik. Historisch betrachtet, geht das Gebiet Palästinas auf die Zeit des Römischen Reiches zurück, als Kaiser Hadrian es nach dem Bar-Kochba-Aufstand in Syria Palaestina umbenannte. Im Laufe der Jahrhunderte verloren die Palästinenser zunehmend an Autonomie, zuletzt unter der britischen Mandatsherrschaft.
Nach dem Ende des britischen Mandats 1948 und der Gründung Israels folgte der Palästinakrieg, der zur Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlands führte. Heute sind diese Gebiete die Hauptzonen, in denen Palästinenser leben und versuchen, Palästina unabhängig zu gestalten. Die Bevölkerung verteilt sich jedoch auch in andere Länder:
| Region | Anteil der Palästinenser |
|---|---|
| Westjordanland und Gazastreifen | 38% |
| Israel | 12% |
| Arabische Länder | 44% |
| Andere Länder | 6% |
Das heutige Palästina umfasst eine Fläche von 6.020 km², wobei das Westjordanland 5.655 km² und der Gazastreifen 365 km² einnehmen. Im Jahr 2019 lebten knapp 5 Millionen Menschen in diesen Gebieten, was eine hohe Bevölkerungsdichte von rund 780 Einwohnern pro km² ergibt. Auch wenn Palästina unabhängig in der internationalen Anerkennung vielfach auf Herausforderungen trifft, sprachen sich 147 von 193 UN-Mitgliedstaaten für seine Souveränität aus. Ein vollständiger staatlicher Status bleibt jedoch umstritten und bislang von Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht anerkannt.
Die politischen und sozialen Realitäten der palästinensischen Bevölkerung und das Streben nach Unabhängigkeit haben seit der Unabhängigkeitserklärung 1988 und den nachfolgenden Wahlen in den Jahren 1996, 2005 und 2006 zu verschiedenen Entwicklungen geführt. Die jüngsten Raketenangriffe und Entführungen durch Hamas im Oktober 2023 verschärfen die Lage weiterhin, wobei der Status Palästinas international kritisch und aufmerksam verfolgt wird.
Unabhängigkeitserklärung von 1988
Die Palästina Unabhängigkeitserklärung 1988 markiert einen entscheidenden Moment in der Geschichte des Nahen Ostens. Am 15. November 1988 verkündete die PLO in Algier die Unabhängigkeit des Staates Palästina. Diese Erklärung war ein symbolischer Akt, der die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf die palästinensische Frage lenkte.
Im Jahr 1988 proklamierte der Palästinensische Nationalrat den Staat Palästina und berief sich dabei auf die Gebiete gemäß der Resolution 181 (II) der Vereinten Nationen, obwohl die Palästinenser zu diesem Zeitpunkt keine tatsächliche Kontrolle über diese Gebiete hatten. Diese Unabhängigkeitserklärung war ein politisches Signal, das die Entschlossenheit des palästinensischen Volkes unterstrich.
Zu Beginn des Jahres 1989 hatten bereits 65 Staaten den Staat Palästina offiziell anerkannt. Die Bedeutung dieser Anerkennung wurde durch die Tatsache unterstrichen, dass die Türkei das einzige NATO-Land war, das den Palästinenserstaat anerkannte. Diese Anerkennungen stießen auf breites internationales Echo. Im Dezember 1988 wurde die PLO bei den Vereinten Nationen offiziell in „Palästina“ umbenannt, obwohl der Status unverändert blieb.
Die UNO-Vollversammlung anerkannte die Palästinenser als Volk und Völkerrechtssubjekt, jedoch nicht als souveränen Staat. Bis 2012 hatten 147 Staaten den Staat Palästina anerkannt, und im gleichen Jahr wurde Palästina von der UN-Generalversammlung als „non-member observer State“ anerkannt. Mahmud Abbas beantragte mehrfach die Vollmitgliedschaft bei der UN, zuletzt 2011, aber dieser Antrag scheiterte an den komplexen Hürden des Sicherheitsrats.
Interessanterweise gibt die Montevideo-Konvention vier Kriterien für Staatlichkeit vor: eine ständige Bevölkerung, ein definiertes Staatsgebiet, eine Regierung und die Fähigkeit, in Beziehung mit anderen Staaten zu treten. Der Palästina Unabhängigkeitserklärung 1988 genügte diesen Kriterien größtenteils, doch die politische Realität und die andauernden Konflikte im Nahen Osten machen die Anerkennung als vollwertiger unabhängiger Staat weiterhin kompliziert.
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1988 | Proklamation des Staates Palästina durch die PLO |
| 1989 | Offizielle Anerkennung durch 65 Staaten |
| 2011 | Vollmitgliedschaftsantrag bei der UN durch Mahmud Abbas |
| 2012 | Anerkennung als „non-member observer State“ durch die UN |
Auch Jahrzehnte nach der Palästina Unabhängigkeitserklärung 1988 bleibt das Thema von großer Relevanz und wiederkehrenden Kontroversen in der internationalen Politik. Nichtsdestotrotz setzt sich das palästinensische Volk weiterhin für seine Anerkennung und für das Recht auf Selbstbestimmung ein.
Oslo-Abkommen und palästinensische Autonomiegebiete
Das Oslo-Abkommen, unterzeichnet am 13. September 1993, markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte des Nahostkonflikts. Es legte den Grundstein für die Autonomie der Palästinenser in bestimmten Gebieten des Westjordanlands und des Gazastreifens. Mit dem Ziel der friedlichen Koexistenz zwischen Israel und den Palästinensern, wurde das Abkommen weltweit als Hoffnungsschimmer für eine dauerhafte Lösung angesehen. Das Abkommen sah die Gründung einer palästinensischen Autonomiebehörde vor, die Verwaltungsaufgaben in den Autonomiegebieten übernehmen sollte.
Das Oslo II-Abkommen von 1995 präzisierte diese Selbstverwaltungsregelungen weiter und ermöglichte der Autonomiebehörde Palästina, die Kontrolle über mehrere Städte und ländliche Gebiete zu übernehmen. Trotz dieser Vereinbarungen wurde der Friedensprozess durch mehrere Ereignisse überschattet, darunter das Massaker in Hebron 1994 und die Ermordung des israelischen Premierministers Jitzchak Rabin 1995. Diese Tragödien belasteten das Vertrauen auf beiden Seiten erheblich.

Die palästinensische Autonomiebehörde, die infolge des Oslo-Abkommens entstand, steht vor zahlreichen Herausforderungen. Dazu gehören interne politische Spannungen, wirtschaftliche Schwierigkeiten und der Verlust der Kontrolle in einigen Gebieten. Die Bevölkerung der Autonomiegebiete beläuft sich auf etwa 4,632 Millionen Menschen, wobei das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Jahr 2022 etwa 3.464 USD (nominal) betrug.
Die zweite Intifada, ausgelöst im Jahr 2000, führte zu erheblichen Verlusten auf beiden Seiten und einem erneuten Erstarken radikaler Gruppen. Auf internationaler Ebene erhielt Palästina im Jahr 2012 den Beobachterstatus als Nicht-Mitgliedsstaat bei den Vereinten Nationen und trat 2015 dem Römischen Statut bei. Trotz dieser Fortschritte bleibt der Status der palästinensischen Autonomiegebiete nach wie vor ein zentraler Streitpunkt im Nahostkonflikt.
Kontroversen um die Staatsanerkennung Palästinas
Die Internationale Anerkennung Palästinas ist ein heftig debattiertes Thema in der globalen Politik. Seit dem Palästinakrieg 1948, in dessen Folge über 700.000 palästinensische Araber flohen, gibt es reichlich diskussionen über den Status Palästinas. Der Konflikt hatte zur Folge, dass etwa 50% der arabischen Bevölkerung des Mandatsgebiets Palästina ihre Heimat verlassen musste. Dies führte zu signifikanten Migrationen: Zwischen 250.000 und 300.000 Palästinenser flohen oder wurden während des Bürgerkriegs in Palästina 1947–1948 vertrieben. Bis zum Ende des Krieges hatten etwa 711.000 palästinensische Flüchtlinge Zuflucht außerhalb Israels gesucht.
Im Zuge des jahrelangen Konflikts hat die Frage der Internationale Anerkennung Palästinas viele Länder gespalten. Rund 120 Staaten, vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika, haben Palästina mittlerweile anerkannt, während andere, wie die USA, einen Mitgliedschaftsantrag der Palästinenser im Sicherheitsrat mit einem Veto blockieren wollen. Die EU konnte bislang keine einheitliche Position zu dem Thema finden. Trotz allem bleibt die Anerkennung des Staates Palästina ein zentraler Punkt der internationalen Diplomatie.
Die Staat Palästina Kontroversen wurden besonders durch den palästinensischen Vorstoß zur Anerkennung als Staat, der im Mai 2011 angekündigt wurde, neu angefacht. Diese Bestrebungen werden als Antwort auf die Stagnation des Friedensprozesses zwischen Israel und den Palästinensern gesehen, der seit über 20 Jahren keine substantiellen Fortschritte erzielt hat.
| Kriterium | Position |
|---|---|
| Unterstützung von UNO-Kriterien | 3 von 5 |
| Verhandlungen zwischen Palästinensern und Israel | Seit 20 Jahren ohne Einigung |
| Staatliche Anerkennungen | Rund 120 Staaten |
| Position der EU | Keine Einigung |
| US-Position | Veto im Sicherheitsrat |
Obwohl die Internationale Anerkennung Palästinas politisch kompliziert ist, bleibt das Thema ein bedeutender Faktor in den Beziehungen des Mittleren Ostens. Der palästinensische Vorstoß könnte nicht nur ein symbolischer Sieg für die moderate Fatah sein, sondern auch deren Position gegenüber der Hamas stärken, während der Fayyad-Plan weiterhin den Aufbau staatlicher Strukturen in Palästina vorantreibt.
Aktuelle politische Entwicklungen und der Status Palästinas
Die Palästina aktuelle Situation ist tiefgreifend komplex und von globalen diplomatischen Entwicklungen geprägt. Trotz der Anerkennung Palästinas durch 146 der 193 UN-Mitglieder, darunter Länder wie Schweden (2014) und kürzlich Slowenien (2023), bleibt die vollständige Aufnahme in die Vereinten Nationen aufgrund des Vetos der USA im UN-Sicherheitsrat blockiert. Der Staat Palästina hat derzeit den Status eines Beobachters bei den UN, was ihn in seiner Fähigkeit, internationale politische Beziehungen vollständig auszubauen, einschränkt.
Die Zukunft Palästinas wird maßgeblich durch regionale und internationale politische Dynamiken beeinflusst. Obwohl viele zentral- und osteuropäische Länder Palästina bereits seit 1988 anerkennen, sehen größere Staaten wie die USA und Frankreich eine diplomatische Anerkennung als verfrüht an. Sie argumentieren, dass entscheidende Voraussetzungen für einen souveränen Staat derzeit nicht gegeben sind. Insbesondere die ungeklärten Grenzen und der Status von Ost-Jerusalem erschweren eine endgültige Lösung.
Dennoch gibt es in Europa, insbesondere in Ländern wie Irland, Norwegen und Spanien, eine klare Tendenz zur symbolischen Anerkennung Palästinas. Dieser Schritt wird jedoch von vielen als primär politisch motiviert betrachtet und hat begrenzte völkerrechtliche Auswirkungen. Die fortschreitenden Entwicklungen, wie die kürzliche Anerkennung durch Slowenien, zielen häufig auf innenpolitische Unterstützung ab, wie etwa bei den linken und liberalen Wählern in Slowenien. Die Anerkennungen seitens solcher Staaten könnten zwar symbolisch und politisch signifikant sein, doch der tatsächliche Einfluss auf den langfristigen Frieden im Nahen Osten bleibt abzuwarten.