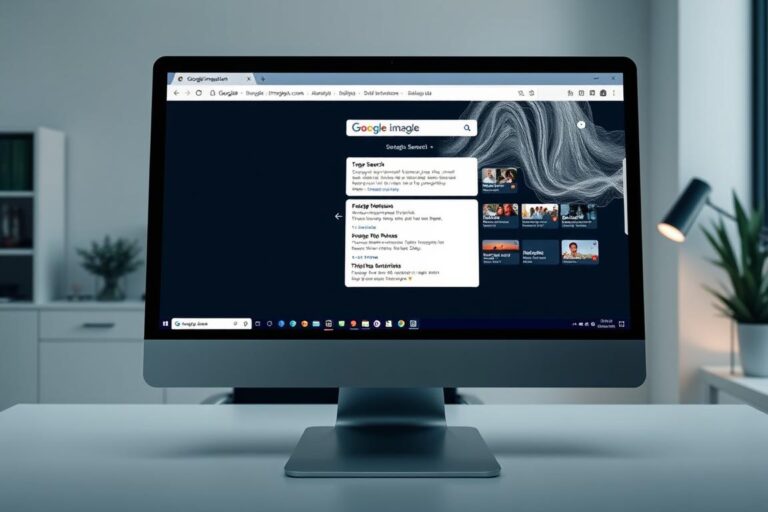Seit wann gibt es Partizipation
Wussten Sie, dass die Partizipation im Wohnungsbau sich erst in den 1960er Jahren entwickelte, als Reaktion auf die monotone Nachkriegsarchitektur und zentralisierte Stadtplanung? Tatsächlich reicht die Geschichte der Partizipation jedoch weit weiter zurück, mit ihren Ursprüngen in den antiken Gesellschaften. Der Begriff Partizipation deutet auf die Einbindung und Beteiligung von Menschen an Entscheidungsprozessen hin, was besonders in demokratischen Systemen als Kernaspekt gilt.
Im Laufe der Zeit hat sich die Partizipation kontinuierlich weiterentwickelt und zeigt unterschiedliche Formen und Grade in verschiedenen kulturellen und politischen Kontexten. Von der politischen Wahlbeteiligung über Bürgerinitiativen bis hin zu e-Partizipationsmöglichkeiten im digitalen Zeitalter – die Entwicklung der Partizipation in Deutschland demonstriert die vielfältigen Wege, wie Menschen aktiv in die politischen und sozialen Prozesse eingebunden werden können. Nicht nur Erwachsenen, auch Kinder und Jugendliche gewinnen zunehmend an Bedeutung, wenn es um ihre Einbindung in Entscheidungsprozesse geht.
Wichtige Erkenntnisse:
- Die Geschichte der Partizipation reicht bis in die antiken Gesellschaften zurück.
- Partizipation im Wohnungsbau entstand als Reaktion auf Nachkriegsarchitektur in den 1960er Jahren.
- Politische Partizipation umfasst sowohl verfasste als auch nicht verfasste Formen.
- E-Partizipation ermöglicht eine zeitlich und örtlich unabhängige Beteiligung.
- Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen gewinnt seit den 1990er und 2000er Jahren an Bedeutung.
- Es gibt signifikante Defizite in der praktischen Umsetzung von Partizipationsangeboten.
- Eine strukturierte und nachhaltige Partizipation soll ein konstitutiver Bestandteil der demokratischen Kultur in Deutschland werden.
Ursprünge der Partizipation in antiken Gesellschaften
Die Ursprünge der politischen Beteiligung können in antiken Gesellschaften wie den griechischen Stadtstaaten und dem Römischen Reich gefunden werden. In Athen erreichte die Demokratie ihre vollständige Ausprägung im 5. Jahrhundert v. Chr., insbesondere zwischen den Perserkriegen und dem Peloponnesischen Krieg. Diese Zeit markierte wichtige Schritte in der Antike Gesellschaften Partizipation.
Die Reformen von Solon beispielsweise führten zur Beseitigung der Schuldknechtschaft und schufen ein System der politischen Beteiligung, das nach Vermögensklassen gestaffelt war. Die Pentakosiomedimnoi, die reichsten Bürger mit einem Ernteertrag von über 500 Scheffeln pro Jahr, waren wählbar zu den höchsten Ämtern, den Archonten. Darunter standen die Hippeis und Zeugiten, die entsprechend niedrigere Ernteerträge hatten und ebenfalls bestimmte politische Rechte ausübten. Die Theten, mit dem geringsten Ernteertrag, konnten zwar an der politischen Mitwirkung teilnehmen, jedoch keine hohen Ämter bekleiden. Dieses Staffelungssystem zeigte, dass die politische Beteiligung Geschichte schrieb, indem sie soziale Unterschiede berücksichtigte.
Wichtige politische Strukturen waren auch der Rat der 500, der von Kleisthenes umgestaltet wurde. Jede der zehn neuen Phylen entsandte 50 Mitglieder in diesen Rat. Ab 487 v. Chr. wurden die Archonten durch ein Losverfahren bestimmt, was die Bedeutung dieses Amtes verringerte. Zudem konnte die Volksversammlung jährlich mittels Ostrakismos einen Bürger für zehn Jahre verbannen, um Machtmissbrauch vorzubeugen.
Obwohl die antiken Partizipationspraktiken weit von den heutigen Demokratievorstellungen entfernt waren und oft nur einem eingeschränkten Personenkreis zugänglich waren, schufen sie doch wesentliche Grundlagen für spätere politische Systeme. Die Antike Gesellschaften Partizipation und die Politische Beteiligung Geschichte in dieser Zeit legten das Fundament für ein allgemeines Verständnis von Bürgerbeteiligung, das sich bis in die moderne Zeit weiterentwickelte.
Partizipation im Mittelalter
Während des Mittelalters war die Mittelalterliche Partizipation hauptsächlich auf lokaler Ebene in den Städten vorhanden. Die Bürger konnten durch Gilden und Zünfte Einfluss auf die städtische Selbstverwaltung nehmen. Diese Institutionen spielten eine entscheidende Rolle, nicht nur in wirtschaftlichen, sondern auch in politischen Angelegenheiten.
Adelige besaßen oft das Recht, an herrschaftlichen Entscheidungen teilzunehmen, was die Bürgerbeteiligung Geschichte prägte. Trotz der hierarchischen Struktur boten diese Mechanismen der Partizipation auch dem einfachen Volk gewisse Mitspracherechte in städtischen Angelegenheiten, die jedoch stark von Ort zu Ort variierten.
Partizipation war zu dieser Zeit keineswegs flächendeckend und hing stark von den spezifischen Gegebenheiten der Region ab. Es ist evident, dass die Mittelalterliche Partizipation den Grundstein für spätere, weiterentwickelte Formen von Bürgerbeteiligung Geschichte legte.
Partizipation in der Neuzeit
Die Epoche der Neuzeit brachte signifikante Entwicklungen in der Neuzeitliche Partizipation mit sich, insbesondere durch die Aufklärung und die daraus resultierenden revolutionären Bewegungen in Amerika und Frankreich. Diese Ereignisse förderten die Idee der Volkssouveränität und stärkte die Forderung nach breiterer politischer Beteiligung. In dieser Zeit wurden die Grundlagen für moderne demokratische Systeme geschaffen, die individuelle Freiheitsrechte und Bürgerbeteiligung in den Vordergrund stellten.
Von besonderer Bedeutung ist die Wahlbeteiligung im Laufe der Zeit als Indikator für politische Entwicklung Partizipation. So lag die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen in den 50er- und 60er-Jahren zwischen 85 und 90 %, während sie 1972 den Höchstwert von 91,1 % erreichte. Interessanterweise erreichte die erste gesamtdeutsche Wahl 1990 mit 77,8 % einen Tiefpunkt in der Wahlbeteiligung, wohingegen die folgende Durchschnittsbeteiligung bei Bundestagswahlen etwa 80 % betrug. Bei Landtags- und Kommunalwahlen ist die Wahlbeteiligung jedoch deutlich geringer. Beispielsweise betrug sie in der Wahlperiode 2001–2005 nur 62,6 %, und bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006 lediglich 44,4 %.
Die Zahlen verdeutlichen, dass die politische Entwicklung Partizipation erhebliche Schwankungen aufweist, was auch durch die Mitgliedschaft in politischen Parteien reflektiert wird. So sank die Parteimitgliedschaft der SPD von 1.022.000 Mitglieder 1976 auf 443.000 im Jahr 2017. Ähnlich verzeichneten auch andere Parteien rückläufige Mitgliederzahlen, mit Ausnahme der Bündnis 90/Die Grünen, die im Jahr 2017 etwa 62.000 Mitglieder hatten. Dies zeigt, dass trotz der historischen Bedeutung neuerlicher Partizipationsformen die aktive Beteiligung in Parteien zurückgegangen ist, während alternative Partizipationsformen möglicherweise an Bedeutung gewonnen haben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Neuzeit entscheidende Fortschritte in der Neuzeitliche Partizipation und der breiteren politischen Einbindung des Bürgers hervorbrachte. Diese Entwicklungen ebneten den Weg für die heutigen demokratischen Strukturen, die verstärkte Bürgerbeteiligung und die ideellen Grundlagen für die moderne partizipative Praxis.
Entwicklung der Partizipation im 19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert fand eine bedeutende Entwicklung der Partizipation statt. Diese Periode war geprägt von der industriellen Revolution und den damit einhergehenden sozialen Veränderungen, die den Druck auf die politischen Systeme erhöhten, politische Rechte auf eine breitere Bevölkerung auszudehnen. Zur Stärkung der Bürgerrechte und zur Förderung der politischen Teilhabe wurden zunehmend allgemeine Wahlrechte eingeführt und politische Parteien gegründet, die die Interessen verschiedener Gesellschaftsschichten vertraten.
Der Wiener Kongress von 1814/1815 bedeutete eine Neuordnung Europas, unterdrückte aber gleichzeitig die liberalen und nationalen Kräfte. Die Juli-Revolution in Frankreich 1830 verstärkte die Freiheitsforderungen des Bürgertums und löste in Deutschland wachsende Forderungen nach Bürger- und Freiheitsrechten sowie politischer Teilhabe aus. Die Nationalversammlung in Frankfurt 1848 proklamierte die Souveränität des Volkes, entwickelte einen Grundrechtekatalog, scheiterte jedoch an den bestehenden Machtverhältnissen.
Die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts für Männer im Norddeutschen Bund 1869 und dessen Ausweitung auf das Deutsche Reich 1871 war ein Meilenstein für die Entwicklung der Partizipation. Während England das allgemeine Wahlrecht erst 1918 einführte, zeigte Deutschland mit der Weimarer Nationalversammlung 1919 bereits frühe Ansätze einer umfassenden Demokratisierung.
Die politische Partizipation im 19. Jahrhundert war daher eine entscheidende Grundlage für die spätere Entwicklung der Bürgerrechte und die Demokratisierung politischer Systeme. Auch wenn der Einfluss des Reichstags auf die Regierungsbildung begrenzt blieb, legten diese Entwicklungen die Basis für eine zunehmend aktivere politische Partizipation der Bürger.
Partizipation in den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts
Im 20. Jahrhundert erlebten verschiedene Länder totalitäre Regime, in denen die Partizipation Totalitarismus stark eingeschränkt oder manipuliert wurde. Klassische Beispiele dafür sind der Nationalsozialismus in Deutschland und der Stalinismus in der Sowjetunion. Unter diesen totalitären Systemen wurde die politische Beteiligung 20. Jahrhundert oft durch propagandistische oder zwanghafte Formen ersetzt, wodurch traditionelle Formen der Partizipation unterdrückt wurden.
In totalitären Regimen wie dem italienischen Faschismus und dem deutschen Nationalsozialismus verschwammen die Grenzen zwischen politischen und wirtschaftlichen Systemen. Diese historische Periode ist besonders prägnant, wenn man die Entwicklung der totalitären Theorie betrachtet, die sowohl die Trennung von Staat und Gesellschaft als auch die Dynamiken innerhalb der totalitären Systeme selbst thematisiert.
Die Theorie des Totalitarismus wurde in den 1920er Jahren entwickelt und hat sich parallel zu den gesellschaftlichen Diskursen weiterentwickelt. Ein bemerkenswerter Wandel in der Totalitarismusforschung trat nach dem „radical epochal break“ von 1989 ein, welcher eine Veränderung des ideologischen Drucks und dessen Auswirkungen auf die Theorie hervorbrachte. Diese Verschiebung reflektiert einen Wandel in der Untersuchung und Interpretation totalitärer Regimes nach dem Ende des Kalten Krieges.
Zahlreiche historische Berichte, insbesondere von ehemaligen Kommunisten, bieten wertvolle Einblicke in die Funktionsweise und Unterdrückung unter totalitären Systemen. Solche Berichte zeigen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in den Verfolgungsmethoden von Nazi- und Stalinistischen Regimen. Die Schriften von Ruth Fischer, einer Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Österreichs, bieten eine historische Perspektive auf die Partizipation Totalitarismus und illustrieren die Komplexität politischer Gedanken in totalitären Kontexten.
Die umfangreiche Forschungsliteratur zu diesem Thema umfasst 592 Seiten und wird von einer detaillierten Bibliographie begleitet, die als gut handhabbar beschrieben wird. Diese Literatur setzt sich kritisch mit Beiträgen sowohl von Befürwortern als auch Kritikern des Totalitarismus auseinander und könnte zu einem „antitotalitären Konsens“ führen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Vergleich zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus, wie er in mehreren Kapiteln detailliert behandelt wird.
| Schlüsselbegriffe | Wichtige Aspekte |
|---|---|
| Autokratie | Staatliche Kontrolle über alle Lebensbereiche |
| Absolutismus | Unbeschränkte Macht des Herrschers |
| Totalitarismus | Ideologischer Druck und Unterdrückung der Partizipation Totalitarismus |
Seit wann gibt es Partizipation im modernen Deutschland
Die moderne Demokratie Deutschland beginnt mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Grundgesetz, das 1949 in Kraft trat, legte den Grundstein für eine solide demokratische Struktur und ermöglichte die breite Partizipation der deutschen Bürger. Schon bei der ersten Bundestagswahl 1949 betrug die Wahlbeteiligung beachtliche 78,5%, was die hohe Partizipation verdeutlicht.
Der Anteil der Wahlberechtigten an der Gesamtbevölkerung stieg kontinuierlich: von 63,4% im Jahr 1949 auf 76,9% bei der Bundestagswahl 2013. Die kontinuierliche Partizipation Entwicklung Deutschland zeigt sich auch in den höchsten Wahlbeteiligungen, die 1972 mit 91,1% und 1976 mit 90,6% gemessen wurden. Hingegen sank die Wahlbeteiligung zwischen 1987 und 2009 auf den niedrigsten Stand seit 1884, 70,8%.
Eine signifikante Entwicklung der Partizipation zeigte sich auch durch die Einführung direkter Demokratieformen wie Volksentscheide und Bürgerinitiativen, die ergänzend zu den Wahlen die politische Mitbestimmung förderten. Diese Instrumente wurden geschaffen, um die Partizipation in der modernen Demokratie Deutschland zu intensivieren und das Vertrauen der Bürger in politische Prozesse zu stärken. Ein wichtiger Faktor für die Partizipation Entwicklung Deutschland war auch die Etablierung von Bürgerbewegungen in den 1960er Jahren, die sich für mehr Mitsprache und Beteiligung einsetzten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über einige der bedeutendsten Statistiken zur Wahlbeteiligung in Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik:
| Jahr | Wahlbeteiligung (%) | Besonderheit |
|---|---|---|
| 1949 | 78,5% | Erste Bundestagswahl |
| 1972 | 91,1% | Höchste Wahlbeteiligung |
| 2009 | 70,8% | Niedrigste Wahlbeteiligung seit 1884 |
| 2013 | 71,5% | Wahlbeteiligung stabilisiert |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Partizipation Entwicklung Deutschland über die Jahrzehnte hinweg durch verschiedene Maßnahmen und politische Reformen stetig gefördert wurde. Das Grundgesetz und die kontinuierliche Anpassung der demokratischen Strukturen haben dazu beigetragen, eine stabile und partizipative Gesellschaft zu schaffen.
Partizipation im geteilten Deutschland
Die Partizipation Deutsche Teilung führte nach dem Zweiten Weltkrieg zu unterschiedlichen Partizipationsmodellen in der DDR und der BRD. Während in der BRD das demokratische System weiterentwickelt wurde und echte Formen der Bürgerbeteiligung entstanden, war die Bürgerbeteiligung DDR und BRD stark unterschiedlich. In der DDR war die Partizipation durch die sozialistische Einparteienherrschaft stark eingeschränkt. Trotz offizieller Propaganda über die politische Beteiligung gab es in der DDR nur begrenzte Möglichkeiten für echte Partizipation.
Die empirischen Studien, wie von Pickel (2002) und verschiedenen Shell-Studien (e.g., Deutsche Shell 2002), haben gezeigt, dass das politische Interesse und die Beteiligung der Bürger in der BRD im Gegensatz zur DDR quantitativ und qualitativ stark variierte. Während die Partizipation in der BRD durch Initiativen wie die „mitWirkung!“-Projekt (Bertelsmann Stiftung 2004a, 2005) und zahlreiche kommunale Beteiligungsprogramme gefördert wurde, war die Bürgerbeteiligung in der DDR weniger frei und oft nur symbolischer Natur.
Die friedliche Revolution von 1989 brachte mit der „Wende“ den starken Wunsch der Bevölkerung nach wirklicher demokratischer Mitsprache zum Vorschein, was letztlich zum Zusammenbruch des sozialistischen Regimes in der DDR führte. Dies markierte den Beginn einer neuen Ära der Partizipation und Bürgerbeteiligung in Ostdeutschland, die sich schließlich auch im vereinten Deutschland weiterentwickelte.
| Aspekte | BRD | DDR |
|---|---|---|
| Politsystem | Demokratie | Sozialistische Einparteienherrschaft |
| Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung | Vielfältig und demokratisch | Stark eingeschränkt |
| Beispiele | „mitWirkung!“-Projekt, kommunale Beteiligungsprogramme | Symbolische Partizipation |
Die unterschiedlichen Partizipationsmodelle während der deutschen Teilung haben die Grundlage für das heutige Verständnis von Demokratie und Bürgerbeteiligung im wiedervereinigten Deutschland geschaffen. Es wird deutlich, dass echte Partizipation der Schlüssel zu einem funktionierenden demokratischen System ist.
Partizipation im digitalen Zeitalter
Das digitale Zeitalter hat die Formen der Partizipation nachhaltig verändert und erweitert. Durch Technologien wie das Internet sind neue Möglichkeiten der E-Demokratie und Online-Bürgerbeteiligung entstanden, die es den Bürgern erlauben, sich schnell und effektiv zu organisieren und Informationen auszutauschen. Diese digitalen Tools bieten nicht nur eine Plattform für die Verknüpfung und Kooperation von Gleichgesinnten, sondern ermöglichen es auch, direkt an politischen Prozessen und Entscheidungen teilzunehmen.
Der Begriff der politischen Partizipation wurde in den 1980er und 1990er Jahren populär, jedoch besteht kein Konsens über seine Definition. Sidney Verba stellte bereits 1972 fest, dass es viele Definitionen von politischer Partizipation gibt. Max Kaase definierte politische Partizipation als alle Tätigkeiten, die Bürger freiwillig unternehmen, um Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen. Mit dem Aufkommen der Digitalisierung hat dieser Begriff eine erneute Fokussierung in wissenschaftlichen Untersuchungen erfahren.
Im Jahr 2020 initiierte das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) ein Projekt zur Entwicklung eines neuen Praxisleitfadens zu „Partizipation im digitalen Zeitalter“. Über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren aktiv in den gesamten Prozess eingebunden. Von Januar bis Mai 2020 fanden drei thematische Workshops und eine Online-Konsultation statt, an denen mehr als 30 Personen teilnahmen und über 170 Kommentare abgaben. Diese Entwicklungen zeigen die Bedeutung von digitaler Partizipation und E-Demokratie in modernen Gesellschaften.