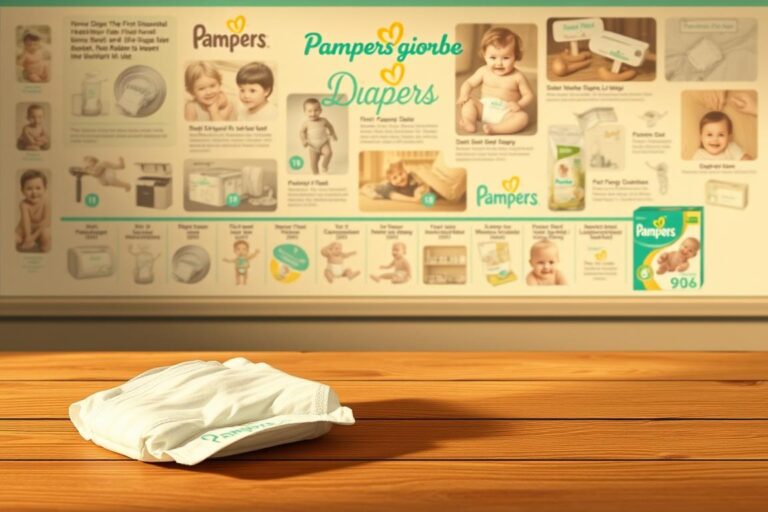Seit wann gibt es Zugewinngemeinschaft
Wussten Sie, dass in Deutschland 100% der Ehepaare, die keine notariellen Eheverträge schließen, automatisch der Zugewinngemeinschaft unterliegen? Seit der Reform des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) im Jahr 1958 prägt die Zugewinngemeinschaft das Vermögensrecht zwischen Ehegatten, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Doch was genau bedeutet Zugewinngemeinschaft und wann hat diese ihren Ursprung?
Zentrale Erkenntnisse
- Die Zugewinngemeinschaft ist der gesetzliche Güterstand für verheiratete Paare in Deutschland seit 1958.
- Vermögen, das durch Erbschaft oder Schenkung erlangt wird, bleibt von der Zugewinngemeinschaft ausgeschlossen.
- Die Zugewinngemeinschaft beginnt am Tag der standesamtlichen Eheschließung.
- Bei der Beendigung der Ehe durch Scheidung erfolgt ein Zugewinnausgleich, wobei der Ehepartner mit dem geringeren Vermögenszuwachs Anspruch auf die Hälfte der Differenz des Zugewinns hat.
- Der Zugewinn wird als Differenz zwischen dem Endvermögen und dem Anfangsvermögen definiert gemäß § 1373 BGB.
- Ein Ehevertrag kann die Zugewinngemeinschaft modifizieren oder ausschließen, was besonders bei Unternehmern häufig vorkommt.
Historische Entwicklung der Zugewinngemeinschaft in Deutschland
Die rechtliche Grundlage der Zugewinngemeinschaft wurde mit dem Inkrafttreten des Gleichberechtigungsgesetzes am 1. Juli 1958 etabliert. Zuvor galt eine Regelung aus dem Jahr 1900, die eine Vermögenstrennung mit einer Verwaltungs- und Nutzungsgemeinschaft beinhaltete. Diese frühere Regelung gab dem Mann administrative Vorrechte über das in der Ehe erworbene Gut, was oft zu Ungerechtigkeiten für die Frau führte.
Mit der Einführung des Güterrechts im Juli 1958 und der späteren Anpassung in den neuen Bundesländern ab dem 3. Oktober 1990 wurde eine modernere Herangehensweise geschaffen, die Geschlechtergerechtigkeit in den Fokus rückte. Diese wichtige Änderung markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Zugewinngemeinschaft und förderte die Gleichstellung der Ehepartner.
Eine bedeutende Überarbeitung des Ehe- und Familienrechts fand am 1. September 2009 statt, wobei die grundlegenden Prinzipien der Zugewinngemeinschaft weiterhin als bewährt angesehen wurden. Am 1. Mai 2013 trat der deutsch-französische Wahlgüterstand in Kraft, der sich an den Vorschriften der Zugewinngemeinschaft orientierte und den Austausch zwischen den Rechtssystemen verstärkte.
In der Praxis spielt die Gütergemeinschaft eine untergeordnete Rolle, insbesondere in ländlichen Gebieten, während die Zugewinngemeinschaft als gesetzlicher Güterstand gilt, falls nichts anderes durch Ehevertrag vereinbart wurde. Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft wurde im deutschen Recht seit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Jahr 1900 geregelt und gilt automatisch, wenn keine anderen Regelungen getroffen werden.
| Jahr | Ereignis | Relevanz |
|---|---|---|
| 1900 | Einführung des BGB mit Verwaltungs- und Nutzungsgemeinschaft | Dominanz des Mannes |
| 1. April 1953 | Außer Kraft setzen diskriminierender Normen gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes | Schritt zur Gleichberechtigung |
| 1. Juli 1958 | Einführung der Zugewinngemeinschaft | Fördert Geschlechtergerechtigkeit |
| 3. Oktober 1990 | Anpassung in neuen Bundesländern | Einheitliches Güterrecht |
| 1. September 2009 | Überarbeitung des Ehe- und Familienrechts | Modernisierung |
| 1. Mai 2013 | Inkrafttreten des deutsch-französischen Wahlgüterstands | Internationaler Austausch |
Seit wann gibt es Zugewinngemeinschaft
Die *Zugewinngemeinschaft* ist seit dem 1. Juli 1958 der gesetzliche Güterstand in Deutschland, eingeführt durch das Gleichberechtigungsgesetz. Mit der *Einführung des Güterstandes* in Westdeutschland wurde ein gerechteres System etabliert, welches die zuvor ungleichen Verwaltung- und Nutznießungsrechte beider Ehegatten ausglich.
Ein markanter *rechtliche Veränderungen* trat am 3. Oktober 1990 auf, als aufgrund der Wiedervereinigung die Zugewinngemeinschaft auch in den neuen Bundesländern legalisiert wurde. Ehepaare, die vor diesen Stichtagen geheiratet hatten, wurden automatisch in die Zugewinngemeinschaft überführt, sofern keine gegenteilige gerichtliche Erklärung vorlag.
Wesentliche Änderungen an den Regelungen der Zugewinngemeinschaft traten am 1. September 2009 in Kraft, um Einzelfallgerechtigkeit zu fördern. Diese Reform ermöglichte es, Verbindlichkeiten sowohl beim Anfangs- als auch beim Endvermögen in die Berechnung des Zugewinnausgleichs miteinzubeziehen, was spezifisch in § 1374 Abs. 3 BGB und § 1375 Abs. 1 BGB verankert ist.
Der Zugewinnausgleich spielt eine wirtschaftlich bedeutende Rolle im Falle einer Scheidung. In der Regel erfolgt der Ausgleich in Form einer Geldzahlung und bleibt steuerfrei. Der Anspruch auf Zugewinnausgleich verjährt nach § 195 BGB mit einer Frist von drei Jahren, gehemmt, solange die Ehe besteht. Im Todesfall wird der Zugewinnausgleich durch eine pauschale Erhöhung des gesetzlichen Erbteils des überlebenden Ehegatten durchgeführt (§ 1931 BGB; § 1371 BGB).
Zugewinnausgleich und seine Bedeutung
Der Zugewinnausgleich tritt im Falle einer Ehescheidung oder des Todes eines Ehegatten in Kraft. Er berechnet sich aus der Differenz des Anfangs- und Endvermögens der Ehegatten während der Ehezeit. Dieser Mechanismus zielt darauf ab, eine gerechte Verteilung des während der Ehe erarbeiteten Vermögens sicherzustellen, und basiert auf dem Gedanken der finanziellen Fairness und Solidarität zwischen den Ehegatten.
Der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft gilt, wenn kein notarieller Ehevertrag abgeschlossen wurde (§ 1363 BGB). Anspruch auf Zugewinnausgleich besteht bei Beendigung des Güterstands durch Scheidung, Tod eines Ehegatten oder durch einen Ehevertrag. Die Berechnung erfolgt, indem das Vermögen zu Beginn und zum Ende des Güterstands verglichen wird.
| Einzelheiten | Herr Engel | Frau Engel |
|---|---|---|
| Anfangsvermögen | 10.000 € | 15.000 € |
| Endvermögen | 100.000 € | 25.000 € |
| Höhe des Zugewinns | 90.000 € | 10.000 € |
| Unterschied im Zugewinn | 80.000 € | |
| Ausgleichsforderung | Frau Engel stehen 40.000 € zu | |
Der Partner mit dem höheren Zugewinn muss den Vermögensunterschied zur Hälfte ausgleichen, was grundsätzlich durch Geldzahlung erfolgt. Bei einer Ehescheidung, wenn das Endvermögen eines Ehepartners sein Anfangsvermögen übersteigt, wird dieser Ausgleich wirksam. Verluste während der Ehezeit müssen jedoch nicht ausgeglichen werden.
Beim Tod eines Ehegatten erhöht sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft (§ 1371 Abs. 1 BGB). Das Anfangsvermögen kann auch negativ sein, da Schulden abgezogen werden. Der Anspruch auf Zugewinnausgleich verjährt drei Jahre nach der rechtskräftigen Ehescheidung. Besonders ist, dass der Zugewinn eines Gatten nie negativ sein kann, und Verluste während der Ehe werden nicht berücksichtigt.
Verschiedene Güterstände im Vergleich
In Deutschland stehen Ehepaaren verschiedene Güterstände zur Verfügung, von denen jeder seine eigenen Besonderheiten und Auswirkungen hat. Die Zugewinngemeinschaft, geregelt in § 1363 BGB, ist der gesetzliche Güterstand, sofern keine andere Regelung durch einen notariellen Ehevertrag getroffen wird. Bei diesem Güterstand wird das während der Ehe erwirtschaftete Vermögen als von beiden Eheleuten gleichmäßig verdient angesehen, und ein Zugewinnausgleich erfolgt bei Scheidung oder Tod gemäß § 1371 BGB und § 1372 BGB.

Die Gütertrennung (§ 1414 BGB) hingegen schließt jeglichen Vermögensausgleich aus; die Vermögen der Ehepartner bleiben vollständig getrennt. Dies bedeutet, dass bei einer Scheidung oder dem Tod eines Ehepartners kein Zugewinnausgleich stattfindet, was die Vermögensverhältnisse überschaubar hält. Ein weiterer Vorteil der Gütertrennung ist, dass die Ehegatten nicht für Altschulden des jeweils anderen haften.
Die Gütergemeinschaft (§ 1415 BGB) führt zu einer vollständigen Vermischung und gemeinsamen Verwaltung des gesamten Vermögens beider Ehepartner, einschließlich des während der Ehe erwirtschafteten Vermögens. Dies kann zu einer gemeinsamen Haftung für Schulden des anderen Partners führen. Ein Vorteil ist jedoch, dass der überlebende Ehegatte im Todesfall zu 50% miterbt, wenn keine Erben erster Ordnung vorhanden sind.
| Merkmal | Zugewinngemeinschaft | Gütertrennung | Gütergemeinschaft |
|---|---|---|---|
| Vermögensausgleich | Ja, bei Scheidung oder Tod | Nein | Nicht erforderlich, da alles gemeinsames Vermögen ist |
| Haftung für Schulden des Partners | Nur bei Mitunterzeichnung | Nein | Ja |
| Vermögensverwaltung | Getrennt, aber Zugewinn wird ausgeglichen | Getrennt | Gemeinsame Verwaltung |
| Erbrechtlicher Anteil des überlebenden Ehepartners | Zusätzlicher Viertel (§ 1371 BGB) | Nach allgemeinem Erbrecht | 50% bei Erben zweiter Ordnung |
Zugewinngemeinschaft und Erbrecht
Im Rahmen des Erbrechts ermöglicht die Zugewinngemeinschaft dem überlebenden Ehegatten einen pauschalierten Zugewinnausgleich, der den gesetzlichen Erbteil erhöht. Der Zugewinnausgleich im Todesfall beträgt pauschal ¼ (25 %) des Gesamtvermögens, sofern kein Testament vorliegt. Dieser Ausgleich tritt unabhängig davon ein, welcher Ehegatte einen höheren Zugewinn erzielt hat und soll den finanziellen Schutz des überlebenden Partners sicherstellen.
Bei der gesetzlichen Erbfolge beträgt die Erbquote ¼ des Vermögens, wenn Kinder vorhanden sind, und ½ des Vermögens, wenn keine Kinder vorhanden sind. Eine relevante Besonderheit der Zugewinngemeinschaft ist, dass eine Erbschaft nicht zum Zugewinn zählt, sondern dem Anfangsvermögen angerechnet wird. Zum Beispiel: Ein Anfangsvermögen von 50.000 Euro, eine Erbschaft von 70.000 Euro und ein Endvermögen von 150.000 Euro ergibt einen Zugewinn von 30.000 Euro.
Der Pflichtteil in der Zugewinngemeinschaft beträgt ½ der gesetzlichen Erbquote. Mit Kindern liegt der Pflichtteil bei ⅛ der Erbmasse, ohne Kinder bei ¼ der Erbmasse. Im Todesfall erhält der überlebende Partner zusätzlich zu seinem gesetzlichen Erbteil ein Ausgleichsviertel oder Zugewinnviertel, um den finanziellem Schutz zu gewährleisten.
Im folgenden Überblick sind die Verhältnisse der gesetzlichen Erbfolge in der Zugewinngemeinschaft detailliert dargestellt:
| Situation | Erbquote | Pflichtteil |
|---|---|---|
| Mit Kindern | ¼ des Vermögens | ⅛ der Erbmasse |
| Ohne Kinder | ½ des Vermögens | ¼ der Erbmasse |
Eine zentrale Rolle spielt die gesetzliche Erbfolge, welche automatisch zur Anwendung kommt, wenn kein Testament vorhanden ist. Der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft gilt automatisch bei Eheschließung, es sei denn, ein Ehevertrag regelt etwas anderes.
Modifizierte Zugewinngemeinschaft durch Ehevertrag
Durch einen Ehevertrag können Ehegatten die gesetzlichen Regelungen der Zugewinngemeinschaft individuell anpassen und somit eine modifizierte Zugewinngemeinschaft schaffen. Dies ermöglicht es, bestimmte Vermögenswerte, wie zum Beispiel ein Unternehmen oder Immobilien, von dem Zugewinnausgleich auszuschließen. Nicht selten nehmen Eheleute diese Möglichkeit wahr, um spezifische Regelungen zu treffen, die ihre persönlichen Vermögensverhältnisse besser widerspiegeln oder um den Vermögensschutz zu gewährleisten.
Die modifizierte Zugewinngemeinschaft bietet den Ehegatten zudem die Flexibilität, finanzielle Aspekte ihrer Ehe nach ihren Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten. So können sie beispielsweise festlegen, dass Betriebsvermögen oder andere wertvolle Besitztümer nicht in den Zugewinnausgleich einfließen. Im Todesfall bietet sie zudem steuerliche Vorteile, denn im Gegensatz zur Gütertrennung fällt auf den Zugewinn keine Erbschaftssteuer an.
Um die modifizierte Zugewinngemeinschaft rechtsverbindlich zu machen, muss der Ehevertrag notariell beurkundet werden. Diese Notarielle Beglaubigung stellt sicher, dass alle Vereinbarungen rechtlich einwandfrei sind und im Falle einer Scheidung Bestand haben. Die Kosten für den Notar richten sich nach dem Geschäftswert, der im Ehevertrag festgehalten wird. Auf diese Weise können Eheleute eine maßgeschneiderte finanzielle Absicherung und eine gerechte Verteilung ihres gemeinsamen Vermögens sicherstellen, die ihren individuellen Lebensumständen entspricht.